Zusammenfassung
Eine Musikstunde zeigt: 70% der Schüler*innen haben keine Musik in ihren Social-Media-Feeds – Algorithmen fragmentieren unsere gemeinsame Realität und stellen Bildung vor fundamentale Fragen.
Was eine Musikstunde über Realitäten verrät
Dienstag, zweite Stunde, 9. Klasse. Ich stelle meinen Schüler*innen eine Aufgabe, die mir einfach erscheint: „Öffnet eure Social-Media-Apps und sucht Posts in eurem Feed, in denen Musik eine Rolle spielt. Egal ob TikTok, Instagram oder YouTube – findet Beispiele, wie Musik in eurem digitalen Alltag vorkommt.“
Ich erwarte eine lebhafte Diskussion über Musikvideos, Lip-Sync-Challenges, Konzertankündigungen, vielleicht virale Tänze. Stattdessen passiert etwas anderes: Über 70% meiner Schüler*innen finden nichts. Nichts mit Musik. In ihrem gesamten Feed.

„Frau Gulcz, bei mir kommt nur KI-Zeug.“
„Bei mir nur Autos und Motoren.“
„Ich hab nur Nachrichten über den Krieg.“
Die Erkenntnis trifft mich unerwartet: Wir sprechen nicht mehr über dieselbe Welt.
Wie Algorithmen unsere Wahrnehmung der Realität fragmentieren
Die Unterrichtsstunde ist Teil einer Forschungskooperation mit Phillip Gosmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des am Institut für Begabungsforschung in der Musik an der Universität Paderborn. Er forscht im Rahmen des KuMuS-ProNeD, Teilprojekt Universität Paderborn (Projektleitung: Prof. Dr. Marc Godau) zu digitalen Kulturpraxen im Bereich Musik. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Laufzeit: 07/23–02/26). Gemeinsam wollten wir erkunden: Welche Formen der Musikkultur finden digital statt? Wie partizipieren Jugendliche heute an Musik – durch Remixes, Creator-Kultur, Community-Building?
Die Unterrichtsreihe war didaktisch durchdacht. Aber was dann geschah, war wichtiger als alles Geplante: Wir entdeckten, wie stark Algorithmen die Realitätswahrnehmung von Jugendlichen bereits prägen.
Die algorithmische Filterblase im Klassenzimmer: Ein Fallbeispiel
Als ich durch die Klasse gehe und auf die Bildschirme schaue, wird das Ausmaß der Fragmentierung sichtbar:
Lena (Name geändert) sieht fast ausschließlich KI-generierte Inhalte – morphende Gesichter, surreale Bilder. Sie folgt niemandem, der Musik postet. Der Algorithmus hat entschieden: Lena ist die „KI-Interessierte“.
Malik bekommt ausschließlich Nachrichtenschnipsel über internationale Konflikte – Drohnen-Aufnahmen, politische Kommentare, Kriegsberichterstattung. Kein einziger Post über Musik. Für den Algorithmus ist Malik der „politisch Interessierte“.
Tim scrollt durch eine Endlosschleife von Sportwagen und Motor-Sounds. Sein gesamter Feed dreht sich um Autos und Tuning. Musikpraxis? Fehlanzeige.
Ich wusste theoretisch, dass Social-Media-Feeds personalisiert sind. Ich kannte das Konzept der Filterblase. Aber es im Klassenzimmer zu erleben – die extreme Unterschiedlichkeit der digitalen Welten mit eigenen Augen zu sehen – war dennoch erschütternd.
Eine wichtige Selbsterkenntnis: Trotz allem theoretischen Wissen sehen wir als Erwachsene ja nur selten fremde Feeds. Wir reden von „Social Media“ als gemeinsamem Raum. Doch dieser gemeinsame Raum existiert nicht. Es gibt nur Millionen individueller algorithmischer Blasen.
Die zentrale pädagogische Frage lautet: Wie soll ich über „digitale Musikkultur“ sprechen, wenn 70% meiner Klasse in ihrem digitalen Alltag gar keine Musik begegnet?
Daraus ergibt sich die größere gesellschaftliche Frage: Wie bilden wir Jugendliche zu mündigen Bürger*innen einer gemeinsamen Gesellschaft, wenn die Grundlage dieser Gesellschaft – eine geteilte Wahrnehmung der Realität – nicht mehr existiert?

Social Media im Unterricht: Die Herausforderung der digitalen Privatsphäre
Während ich die Klasse beobachte, wird mir eine zweite Dimension des Problems bewusst: Der Social-Media-Feed ist kein neutrales Lehrmaterial. Er ist zutiefst persönlich.
Ich bitte meine Schüler*innen gerade, ihr privates Smartphone zu öffnen. Ihr persönlichster digitaler Raum. Der Feed ist ein algorithmischer Spiegel ihrer Interessen, Ängste und Sehnsüchte. Der Algorithmus kennt sie besser als ich es je könnte.
Einige Schülerinnen zögern. Sie wollen nicht, dass ich oder ihre Mitschülerinnen sehen, was auf ihrem Bildschirm erscheint. Diese Reaktion ist berechtigt.
Didaktisches Dilemma: Lebenswelt einbeziehen ohne Grenzen zu überschreiten
Social Media im Unterricht zu thematisieren ist theoretisch simpel. Praktisch stellt es Lehrkräfte vor eine ethische Herausforderung:
- Einerseits ist es unser Bildungsauftrag, die digitale Lebenswelt der Schüler*innen einzubeziehen
- Andererseits bedeutet der Blick auf den Feed einen massiven Eingriff in die Privatsphäre
Die Grenze zwischen „Lebenswelt einbeziehen“ und „Privatsphäre verletzen“ ist hauchdünn. Diese Erkenntnis hat direkte Konsequenzen für meine Unterrichtspraxis: Die Beziehungsebene wird immer wichtiger – auch und gerade im Fachunterricht.

Kulturelle Teilhabe in Zeiten algorithmischer Fragmentierung
Ursprünglich wollten wir mit der Unterrichtsreihe über kulturelle Teilhabe sprechen:
- Neue Formen von Musikproduktion und -distribution
- Empowerment durch digitale Tools
- Creator Economy und Remix-Kultur
- Wie Jugendliche Musik heute selbst gestalten, nicht nur konsumieren
Während ich beobachte, wie Finger reflexartig über Bildschirme wischen – selbst als wir längst zur nächsten Aufgabe übergegangen sind – wird mir die Kernfrage bewusst:
Teilhabe woran?
Wenn 70% meiner Klasse keine Musik im Feed sehen, wenn jede*r in einer völlig anderen algorithmischen Realität lebt – von welcher gemeinsamen Kultur sprechen wir dann?
Die Unterrichtsreihe sollte zeigen, wie digitale Kulturpraxis funktioniert. Was sie tatsächlich zeigt: Die Voraussetzung für gemeinsame kulturelle Teilhabe – eine geteilte Wahrnehmung – existiert nicht mehr.
Das ist keine Frage nur für den Musikunterricht. Das ist die zentrale Frage für Bildung im digitalen Zeitalter.
Was algorithmische Personalisierung für Bildung bedeutet
In meinem Garten achte ich darauf, dass jede Pflanze bekommt, was sie braucht. Manche brauchen Schatten, andere Sonne, manche viel Wasser, andere wenig. Aber alle wachsen im selben Garten, unter demselben Himmel, in derselben Erde.
Im digitalen Raum wächst jede*r in einem eigenen Gewächshaus – mit eigenem Licht, eigener Temperatur, eigener Nährstoffzufuhr. Das Erschreckende: Die meisten merken nicht mal, dass es andere Gewächshäuser gibt.
Der Verlust gemeinsamer Referenzpunkte
Schule war schon immer divers:
- Unterschiedliche soziale Hintergründe
- Unterschiedliche kulturelle Prägungen
- Unterschiedliche Zugänge zu Bildung
Das ist nichts Neues. Aber es gab immer noch gemeinsame Referenzpunkte:
- Die Fußball-WM
- Ein virales Video
- Ein Song, der überall lief
- Ereignisse, die eine gemeinsame Gesprächsgrundlage schufen
Diese gemeinsamen Referenzpunkte gibt es nicht mehr.
Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Schülerinnen digital dieselbe Welt teilen. Jeder lebt in einer algorithmisch kuratierten Realität, und diese Realitäten überschneiden sich immer weniger.
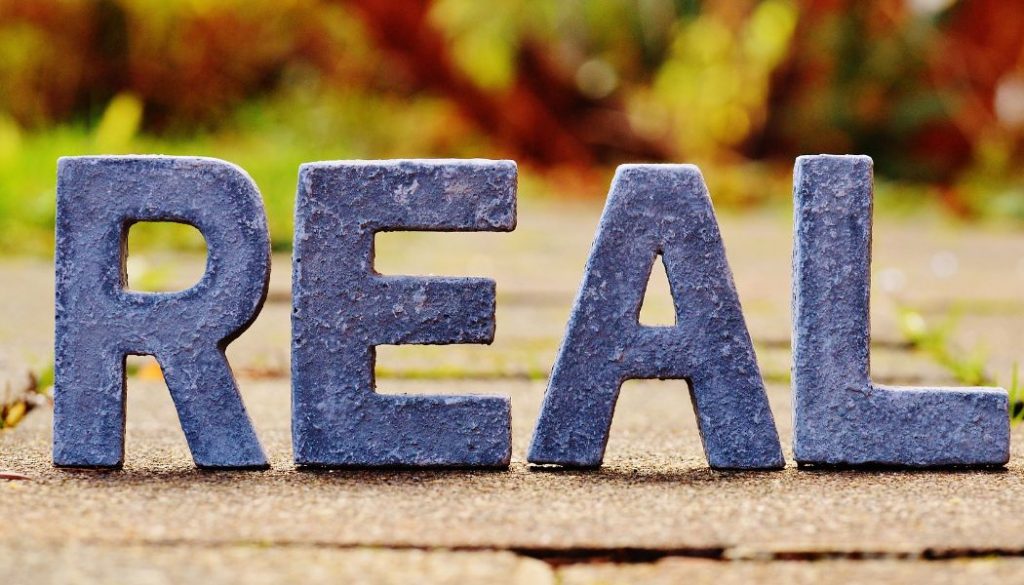
Die neue Rolle von Lehrkräften im Zeitalter der Algorithmen
Als Lehrerin frage ich mich: Was ist eigentlich meine Aufgabe?
Früher lautete die Antwort: Horizonte erweitern. Neue Perspektiven zeigen. Den Blick weiten.
Aber heute? Wenn ich Schüler*innen sage: „Such mal nach #openversechallenge“ oder „Schau dir diesen Creator an“ – dann impfe ich ihren Feed. Ich verändere ihren Algorithmus. Ich lenke ihre digitale Realität.
Das wirft grundlegende Fragen auf:
- Ist das Bildung?
- Oder ist das Manipulation?
- Wo verläuft die Grenze zwischen „Lebenswelt einbeziehen“ und „Lebenswelt manipulieren“?
Der Algorithmus ist schnelllebig – ein Hashtag heute, morgen vergessen. Aber die ethische Dimension bleibt: Der Feed ist kein Schulbuch, das ich verteile. Er ist ein algorithmischer Spiegel der Identität meiner Schüler*innen.

Medienkompetenz neu denken: Vier Konsequenzen für die Bildungspraxis
Aus diesem Unterrichtsexperiment ziehe ich folgende Schlüsse:
1. Wir brauchen Transparenz über algorithmische Systeme
Schüler*innen müssen verstehen:
- Wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren
- Dass ihr Feed nicht „die Realität“ ist, sondern eine kuratierte Auswahl
- Dass andere Menschen völlig andere Inhalte sehen
2. Wir müssen gemeinsame Räume schaffen
In einer fragmentierten digitalen Welt wird es wichtiger, bewusst gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen – auch analog.
3. Wir brauchen neue Formen der kulturellen Teilhabe
Wenn gemeinsame Referenzpunkte fehlen, müssen wir im Unterricht aktiv geteilte Erlebnisse schaffen und reflektieren.
4. Wir müssen die Grenze zwischen Bildungsauftrag und Privatsphäre neu verhandeln
Der Einsatz von Social Media im Unterricht erfordert:
- Sensibilität für die Privatsphäre der Jugendlichen
- Transparenz über didaktische Absichten
- Freiwilligkeit statt Zwang
Fazit: Die Frage, die Bildung neu denken lässt
Ich habe keine abschließenden Antworten. Aber ich weiß: Wir müssen dringend darüber sprechen.
Nicht nur über Algorithmen.
Nicht nur über Medienkompetenz.
Sondern über die fundamentale Frage:
Wie schaffen wir es, Jugendliche zu mündigen Bürger*innen einer gemeinsamen Gesellschaft zu bilden, wenn die Grundlage dieser Gesellschaft – eine geteilte Wahrnehmung der Realität – nicht mehr existiert?
Das ist nicht nur eine Frage für den Musikunterricht.
Das ist die zentrale Frage für Bildung im digitalen Zeitalter.
Diskutiere mit: Deine Erfahrungen mit Algorithmen in der Bildung
Fragen an dich:
- Hast du schon erlebt, wie unterschiedlich die Social-Media-Feeds deiner Schüler*innen sind?
- Wie gehst du damit um, wenn du digitale Inhalte im Unterricht nutzen willst?
- Welche Grenzen setzt du dir beim Einbeziehen der digitalen Lebenswelt?
- Wo siehst du die Verantwortung von Schule in einer Welt algorithmischer Filterblasen?
Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren. Lass uns voneinander lernen – denn diese Fragen können wir nur gemeinsam beantworten.